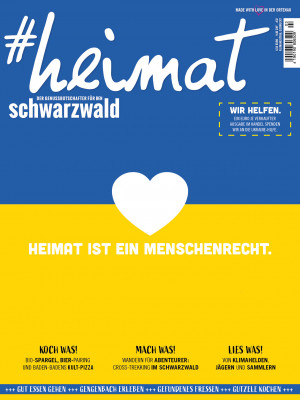Wer mit offenen Augen durch die Weinberge geht, sieht immer öfter auch Parzellen, die nicht bewirtschaftet werden. Woran liegt das? Gehen uns die Winzer aus?
Es hat nicht eins zu eins mit dem Rückgang der Zahl der Winzer zu tun, denn der Strukturwandel ist ja eine Entwicklung, die wir schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten haben. Der badische Weinbau war in früheren Zeiten noch wesentlich stärker von Nebenerwerbswinzern geprägt. Da hat sich viel verändert, die Betriebe sind größer geworden, und deswegen gibt es automatisch weniger Winzer. Die Rebfläche in Baden ist bis dato sehr stabil, wir sind seit Jahrzehnten bei knapp unter 15 000 Hektar. Da stellen wir auch noch keinen großen Flächenschwund fest. Es gibt aber auch Flächen, die nicht mehr in der Bewirtschaftung sind. Das liegt häufig daran, dass die Bewirtschaftung ökonomisch nicht mehr möglich war. Weil natürlich viel Handarbeit nötig ist und die Geld kostet. Wenn es nicht gelingt, die Ausgaben für die Bewirtschaftung über den Verkaufspreis wieder zurückzuholen, kommt es dazu, dass solche Flächen aus der Bewirtschaftung fallen. Das macht uns vor allem da Sorgen, wo sie sich mitten im Umfeld noch bewirtschafteter Flächen befinden.
Was bedeutet dieser Strukturwandel für uns Weintrinker: mehr oder weniger Vielfalt?
Wir haben in Baden eine ausreichend große Vielfalt. Oft wünschen wir uns sogar etwas weniger Vielfalt und dafür klarere Profile. Vielfalt an sich ist nichts Schlechtes, aber schwer zu vermarkten. Und genau das unterscheidet Baden vom Bordeaux. Wir tun uns in Deutschland sehr schwer mit Typenweinen, wie sie aus dem Bordeaux oder dem Barolo bekannt sind. Da ist dem Endverbraucher klar, was er später im Glas zu erwarten hat. Das ist bei uns mit unserer Sortenvielfalt nicht gegeben. Wir wollen daher gern ein klareres Profil für die badischen Weine entwickeln.
Den badischen Burgunder?
Im ersten Schritt gibt es sicher einen badischen Burgunder und den gibt es in Weiß oder Rot. Aber die Frage ist, ob irgendwann überhaupt noch eine Sorte erscheinen muss. Denn wie gesagt: Wenn Sie ins Ausland schauen, steht auf einem Barolo nicht zwangsläufig die Rebsorte. In Bordeaux ist es ähnlich, in der Champagne auch. Es geht also um Typenweine und Weinstile. Da könnten wir als Burgunderparadies schon punkten.
Machen wir mal ein Szenario auf. Wo steht der badische Wein in zehn Jahren? Wird er nachhaltiger sein, gibt es größere Betriebe?
Größere Betriebe wird es sicherlich geben. Das ist die allgemeine Entwicklung. Wobei größer nicht Megafactory heißen muss. Vielmehr werden die privatwirtschaftlichen Weingüter noch etwas zulegen, weil man erst ab einer gewissen Größe profitabel arbeiten kann. Selbstverständlich werden wir auch nachhaltiger sein. Wir starten vom Verband aus eine Nachhaltigkeitsinitiative für unsere Betriebe, damit sich jeder in diesem Bereich auf den Weg macht. Gleichzeitig möchten wir eine gewisse Einheit unter den Betrieben herstellen, und zwar unter allen Betriebsformen. Egal ob Winzergenossenschaft, Kellerei oder Privatweingut: Gemeinsam kann man einfach mehr erreichen! Und da haben wir in Baden noch ein bisschen was zu tun.
Und dieses Nachhaltigkeitsprogramm ist bewusst nicht bio, sondern nachhaltig? Gibt es dazu schon Leitlinien?
Es gibt Leitlinien, die wir aber nicht selbst entwickelt haben. Für uns ist jetzt die Frage: Was können wir von Programmen übernehmen, die schon da sind? Man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Ich möchte auch nicht, dass jeder Betrieb direkt in ein Zertifizierungsverfahren einsteigen muss. Wichtiger ist, dass sich eine Vielzahl an Betrieben auf den Weg macht, über Nachhaltigkeit im praktischen Arbeiten nachzudenken, sowohl ökologisch wie ökonomisch und sozial. In allen drei Säulen der Nachhaltigkeit gibt es in unserer Branche Verbesserungspotenziale, und insofern ist für mich Nachhaltigkeit als Überbegriff bedeutender als rein die Ökologie. Nachhaltiges Wirtschaften versetzt unsere Betriebe ganz einfach in die Lage, tatsächlich in Zukunft noch Wein erzeugen zu können.
Das alles muss man dem Verbraucher aber erst einmal erklären – und bislang war der badische Wein da eher ein Leisetreter …
Lassen Sie mich dazu kurz unsere neue Dachmarke „Baden – der Garten Deutschlands“ ansprechen. Diese Marke ist gekennzeichnet durch drei wesentliche Markenkerne: die Natürlichkeit, den Genuss und eine gewisse Gelassenheit, für die Baden schon immer steht. Um eben diese Natürlichkeit leben zu können, brauchen wir eine gesunde Natur, funktionierende Kreisläufe, und das können wir nur dadurch erreichen, dass wir nachhaltig denken und handeln. Dieses Engagement wollen wir zukünftig unter anderem in Form unserer Dachmarkenkampagne erzählen. Baden ist der Garten Deutschlands, dieser Garten blüht und ist ein nachhaltiger Lebensraum für alle, die sich darin befinden.
Ich persönlich denke bei Garten eher an die Mainau und ihre Gemüsefelder als an die Steillagen der Ortenau oder den Kaiserstuhl mit seinen vulkanischen Böden. Aber wie ist das in der Branche? Gibt es eine große Einigkeit, dass der Garten der richtige Weg ist?
Die Branche hat diese Dachmarke selbst entwickelt. Das waren nicht nur einige wenige Köpfe, sondern da gab es schon eine breite Beteiligung. Ich bin überzeugt: Je mehr und intensiver wir die Ideen dahinter kommunizieren, desto mehr wird es auch verständlich. Wir sehen den Garten als sehr vielfältigen, sehr grünen, sehr natürlichen Lebensraum, als Ort des Rückzugs, als Ort des Genusses, als Ort der Begegnung. Und wer Baden so noch nie wahrgenommen hat, war vermutlich noch nie hier. Wir liegen am Waldrand des Schwarzwaldes, haben mit dem Bodensee den schönsten Gartenteich der Welt, einen Bach in Form des Rheins, der an unserem Garten vorbeifließt. Dazwischen haben wir eine unheimliche Vielfalt an Vegetation, an Landschaften, an Kulturen, von den Alemannen bis zu den Kurpfälzern. Wir haben blühende Landschaften, wenn man so möchte, und wir haben mit den Franzosen, Schweizern und Österreichern nette Gartennachbarn, zu denen wir gute Kontakte pflegen. Von daher denke ich, dass das Gartenbild für Baden mehr als zutreffend ist.